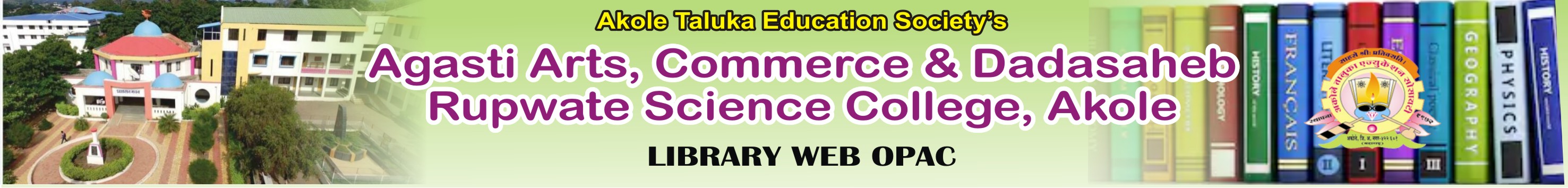Sterben dürfen im Krankenhaus. Paradoxien eines ärztlichen Postulats in der Behandlung Schwerstkranker
Behzadi, Asita
Sterben dürfen im Krankenhaus. Paradoxien eines ärztlichen Postulats in der Behandlung Schwerstkranker - De Gruyter 2021 - 1 electronic resource (280 p.)
Open Access
Krankenhäuser sind und bleiben perspektivisch mit 50% aller Todesfälle der häufigste Sterbeort in Deutschland. Und obwohl der Nutzen einer palliativmedizinischer Versorgung im gesamten Behandlungsverlauf wissenschaftlich gezeigt wurde, gibt es eine Forschungslücke hinsichtlich der organisatorischen und sozialen Bedingungen der Integration bzw. der Gründe für ihr Misslingen. Der Titel dieser qualitativen Untersuchung, „Sterben dürfen im Krankenhaus, beinhaltet keinen Aufruf zur aktiven Sterbehilfe. Vorgestellt werden vielmehr Studienergebnisse, die Widersprüche zwischen gesundheitspolitischen Überlegungen, ethisch-moralischem Anspruch, normativen Erwartungen und klinischer Praxis in der Behandlung Schwerstkranker und Sterbender aufzeigen: Im Kontext eines Akutkrankenhauses mit einer ökonomisierten „Durchlaufmedizin und routinierten „Arbeit im Akkord verunsichern Sterbende oder Langlieger als nicht heilbare Patient*innen den medizinischen Enthusiasmus. Zudem erschüttert die Behandlungspraxis im Krankenhaus die ärztlichen Ideale von Zeit und Raum für die Sterbebegleitung. Die vielfache Fehlversorgung Sterbender im Krankenhaus ist verbunden mit einer prekären Arbeitssituation – nicht nur im Hinweis auf den Pflegekräftemangel. Um den zentralen Behandlungsauftrag der Akutbehandlung bzw. Heilung im Krankenhaus aufrechtzuerhalten, lassen sich verschiedene ärztliche Strategien rekonstruieren: eine begriffliche Erweiterung der Akut- und/oder Heilungsorientierung um eine „formal kurative Behandlung, eine diffuse, vermeidende oder einseitig auf Heilung ausgerichtete ärztliche Aufklärung von Patient*in und Angehörigen trotz Verschlechterung der Erkrankungssituation, eine Priorisierung von kurativen vor palliativen Patient*innen bei der Aufnahme, eine schnelle Verlegung Schwerstkranker oder Sterbender aus dem eigenen Arbeitsbereich, oder aber die paradoxe Nicht-Nutzung eines Palliativkonsildienstes trotz formuliertem Unterstützungsbedarf. Im Postulat vom
Creative Commons
German
9783110707151 9783110707151
10.1515/9783110707151 doi
Sterben dürfen im Krankenhaus. Paradoxien eines ärztlichen Postulats in der Behandlung Schwerstkranker - De Gruyter 2021 - 1 electronic resource (280 p.)
Open Access
Krankenhäuser sind und bleiben perspektivisch mit 50% aller Todesfälle der häufigste Sterbeort in Deutschland. Und obwohl der Nutzen einer palliativmedizinischer Versorgung im gesamten Behandlungsverlauf wissenschaftlich gezeigt wurde, gibt es eine Forschungslücke hinsichtlich der organisatorischen und sozialen Bedingungen der Integration bzw. der Gründe für ihr Misslingen. Der Titel dieser qualitativen Untersuchung, „Sterben dürfen im Krankenhaus, beinhaltet keinen Aufruf zur aktiven Sterbehilfe. Vorgestellt werden vielmehr Studienergebnisse, die Widersprüche zwischen gesundheitspolitischen Überlegungen, ethisch-moralischem Anspruch, normativen Erwartungen und klinischer Praxis in der Behandlung Schwerstkranker und Sterbender aufzeigen: Im Kontext eines Akutkrankenhauses mit einer ökonomisierten „Durchlaufmedizin und routinierten „Arbeit im Akkord verunsichern Sterbende oder Langlieger als nicht heilbare Patient*innen den medizinischen Enthusiasmus. Zudem erschüttert die Behandlungspraxis im Krankenhaus die ärztlichen Ideale von Zeit und Raum für die Sterbebegleitung. Die vielfache Fehlversorgung Sterbender im Krankenhaus ist verbunden mit einer prekären Arbeitssituation – nicht nur im Hinweis auf den Pflegekräftemangel. Um den zentralen Behandlungsauftrag der Akutbehandlung bzw. Heilung im Krankenhaus aufrechtzuerhalten, lassen sich verschiedene ärztliche Strategien rekonstruieren: eine begriffliche Erweiterung der Akut- und/oder Heilungsorientierung um eine „formal kurative Behandlung, eine diffuse, vermeidende oder einseitig auf Heilung ausgerichtete ärztliche Aufklärung von Patient*in und Angehörigen trotz Verschlechterung der Erkrankungssituation, eine Priorisierung von kurativen vor palliativen Patient*innen bei der Aufnahme, eine schnelle Verlegung Schwerstkranker oder Sterbender aus dem eigenen Arbeitsbereich, oder aber die paradoxe Nicht-Nutzung eines Palliativkonsildienstes trotz formuliertem Unterstützungsbedarf. Im Postulat vom
Creative Commons
German
9783110707151 9783110707151
10.1515/9783110707151 doi